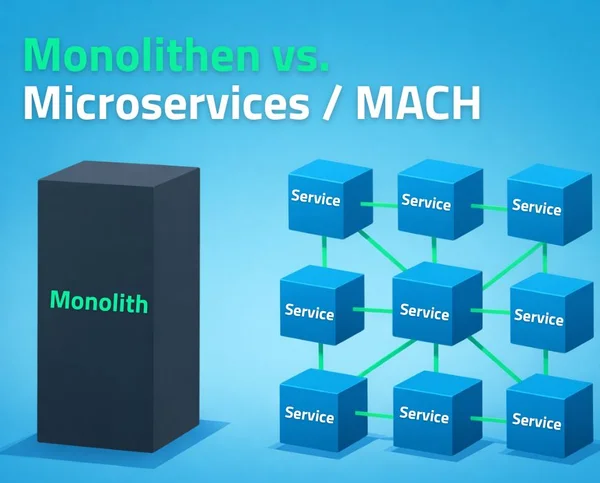In Teil eins und zwei unserer Artikelreihe „Storage on Demand“ behandelten wir die Logik und Vorteile flexibler Speicherlösungen und haben einen Blick auf die physikalische Grundlage der Speicherarchitekturen DAS, NAS und SAN geworfen.
Im dritten Teil widmen wir uns den Speichermedien selbst. Die Wahl zwischen mechanischen Festplatten (HDD), Solid State Drives (SSD) und NVMe-Speichern bestimmt maßgeblich, wie performant, skalierbar und wirtschaftlich ein Storage-on-Demand-System ist. In diesem dritten Teil der Serie beleuchten wir die Unterschiede, Vor- und Nachteile sowie typische Einsatzszenarien dieser Speichertechnologien.
Mechanische Festplatten (HDD)
Mechanische Festplatten (Hard Disk Drives) sind die klassischen Speichermedien und seit Jahrzehnten bewährt. Sie speichern Daten auf rotierenden Magnetscheiben, auf die ein Schreib-/Lesekopf zugreift. Diese Technik ermöglicht große Speicherkapazitäten zu vergleichsweise niedrigen Kosten pro Terabyte. Dies ist ein Grund, warum HDDs vor allem für langfristige Speicherlösungen und Archivierung nach wie vor eine Rolle spielen.
Die Vorteile mechanischer Festplatten liegen in ihrer Kapazität und Wirtschaftlichkeit: Für große Datenbestände, die nicht ständig aktiv genutzt werden, sind sie gut geeignet. Gleichzeitig bergen HDDs aber auch einige Einschränkungen. Die mechanischen Komponenten führen zu höheren Latenzen und geringerer I/O-Performance im Vergleich zu Flash-basierten Lösungen. Außerdem sind sie empfindlicher gegenüber Erschütterungen, verschleißanfälliger und verbrauchen mehr Energie.
Unternehmen sollten zudem zwischen Consumer- und Enterprise-HDDs unterscheiden. Während Consumer-Laufwerke vor allem im Desktopbereich eingesetzt werden, sind Enterprise-HDDs für den Dauerbetrieb optimiert. Sie bieten eine höhere Zuverlässigkeit, längere Lebensdauer und eignen sich für anspruchsvolle Workloads, bei denen konstante Verfügbarkeit entscheidend ist. Typische Anwendungsfälle für HDDs sind Cold Storage (eine archivierte Speicherung von Daten, die keinen laufenden Zugriff erfordern, aber langfristig geschützt werden müssen), Backups oder große Medienarchive, bei denen der Zugriff eher selten erfolgt.
Solid State Drives (SSD)
Solid State Drives basieren auf Flash-Speicher und kommen ohne bewegliche Teile aus. Dadurch sinkt nicht nur die Latenz, die Speichermedien sind auch robuster gegenüber mechanischen Einflüssen. SSDs bieten eine höhere Performance bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch als HDDs.
Der Nachteil liegt im Preis: Pro Terabyte sind SSDs nach wie vor teurer als mechanische Festplatten. Außerdem besitzen Flash-Zellen nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, wenngleich moderne Enterprise-SSDs durch optimierte Controller und Firmware für hohe Belastungen ausgelegt sind.
Typische Einsatzszenarien für SSDs sind operative Systeme, Datenbanken und virtuelle Maschinen. Anwendungen, die schnelle Zugriffe erfordern oder stark I/O-lastig sind, profitieren von der deutlich höheren Geschwindigkeit. Auch hier gilt: Enterprise-SSDs unterscheiden sich von Consumer-Modellen durch höhere Dauerlastfähigkeit, stabilere Performance und längere Lebensdauer.
Ein Praxisbeispiel: Ein SaaS-Anbieter speichert seine aktiven virtuellen Maschinen auf SSDs, um schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige Performance zu gewährleisten, während Archivdaten auf günstigere HDDs ausgelagert werden.
NVMe-Storage
NVMe (Non-Volatile Memory Express) ist ein moderner Speicherstandard für Flash-Speicher über PCIe-Schnittstellen. Er ermöglicht niedrige Latenzen und hohe Datenraten, deutlich schneller als herkömmliche SATA- oder SAS-SSDs. NVMe ist damit die erste Wahl für besonders performance-kritische Workloads, etwa Echtzeit-Analytics, KI/ML-Anwendungen oder High-Performance-Computing.
Die Vorteile: NVMe-Laufwerke liefern hohe IOPS, minimalen Overhead und kurze Zugriffszeiten. Der Nachteil sind die höheren Kosten pro Terabyte und die oft geringere maximale Kapazität im Vergleich zu HDDs. Dennoch bieten sie einen Geschwindigkeitsvorteil für Workloads, die dies erfordern.
Ein Beispiel: In Forschungszentren oder bei Finanzdienstleistern kommen NVMe-Laufwerke für datenintensive Echtzeitanalysen zum Einsatz, während SSDs die laufenden Anwendungen bedienen und HDDs als kostengünstige Backup- und Archivlösung fungieren.
Der Vergleich
Die Wahl der richtigen Speichertechnologie hängt immer vom Einsatzzweck ab. Mechanische Festplatten punkten bei großen Datenmengen mit geringen Kosten. Dagegen liefern SSDs stabile Performance für operative Anwendungen. Und NVMe ermöglicht High-Performance-Workloads mit niedrigen Latenzen. In der Praxis hat sich häufig ein hybrider Ansatz bewährt: HDDs für selten genutzte Daten, SSDs für aktive Arbeitslasten und NVMe für kritische Hochleistungsanwendungen.
Unternehmen, die Storage on Demand nutzen, profitieren von der Flexibilität, diese Technologien bedarfsgerecht zu kombinieren. Workloads können verschoben, erweitert oder verkleinert werden, ohne dass physisch neue Hardware angeschafft werden muss. Das spart nicht nur Kosten, sondern erhöht auch die Effizienz und Reaktionsfähigkeit der IT.
Fazit: Die richtige Speichertechnologie für Storage on Demand
Es gibt keinen universellen Speicher, der für alle Szenarien optimal ist. Entscheidend sind Workload, Performance-Anforderungen, Kosten und Kapazität. Die Storage-on-Demand-Angebote ermöglichen es Unternehmen, genau diese Faktoren zu berücksichtigen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren.
Unternehmen sollten zuerst ihre Workloads analysieren und dann die passende Speicherlösung wählen. Mit unseren unterschiedlichen Storage-on-Demand-Lösungen erreichen Sie sowohl hohe Performance, maximale Flexibilität als auch wirtschaftliche Effizienz.